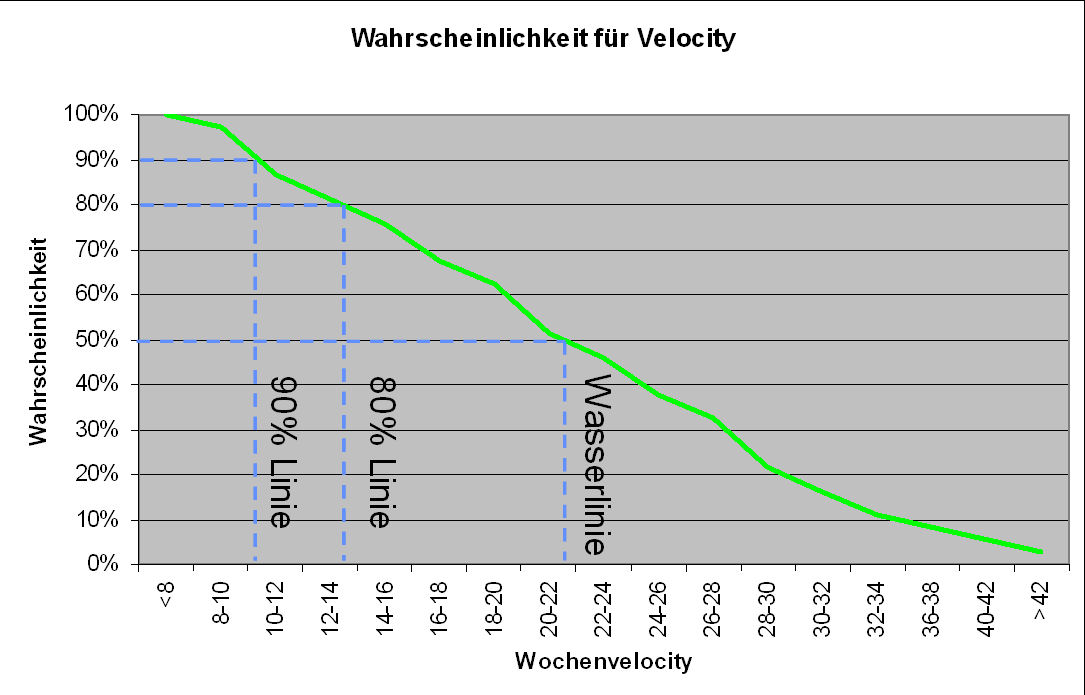„The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams“ heißt es in den viel zu wenig beachteten 12 Prinzipien des agilen Manifests. Nach mittlerweile mehr als einer Dekade Erfahrung mit agiler Entwicklung wird wohl jeder Praktiker dieses Prinzip bestätigten.
Auf Teamebene ist Selbstorganisation mittlerweile Stand der Kunst. Aber wenn es um eine ganze Organisation geht, betritt man noch immer Experimentiergebiet. Wir versuchen bei it-agile, Selbstorganisation so weit zu leben, wie das möglich ist (siehe dazu auch Stefan Roocks Blog-Eintrag) – eine erhebliche Herausforderung, weil die meisten traditionellen Organisationsformen früher oder später auf hierarchische Strukturen zurückgreifen. Nun ist es das eine, von hierarchiefreien, selbstorganisierten Unternehmen zu träumen, etwas anderes, das wirklich umzusetzen. Zumindest, wenn man die Phase des kleinen Startups verlassen hat, das im wesentlichen auf Zuruf funktioniert.
it-agile gehört zu über 70% den derzeit 33 Mitarbeitern, wodurch die Mitarbeiter rein formal jederzeit einen Gesellschafterentscheid herbeiführen können. Bei den meisten Firmen mischen sich Gesellschafter nur sehr wenig in die operativen Abläufe im Unternehmen ein, weil sie ihre Beteiligung eher als Finanzanlage sehen. Unsere Gesellschafter haben aber deutlich mehr im Spiel: Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Rendite, sondern auch ihre tägliche Arbeit. Sie machen daher munter von ihren Möglichkeiten Gebrauch und fällen Entscheidungen über alle Belange, die ihnen wichtig sind. Das Paradies?
Leider hat auch diese weitreichende Selbstorganisation ihre Schattenseiten. Schließlich müssen sich über 30 erwachsene Menschen auf Lösungen einigen. Das führt dazu, dass Entscheidungen intensiv diskutiert werden, was sie nicht immer beschleunigt.
Damit Selbstorganisation funktioniert, benötigt man unstrukturierte Kommunikationskanäle. In vielen Unternehmen tut eine gemütlich eingerichtete Kaffeeküche da schon gute Dienste, wir arbeiten oft über ganz Deutschland verteilt. Als Kaffeeküchenersatz nutzen wir ein internes Microbloggingsystem, das von der Mehrheit der Mitarbeiter fleißig genutzt wird.
Das reicht in der Regel, um einen großen Teil der Probleme zu artikulieren. Sie zu einer Lösung zu führen, ist deutlich schwieriger. In den letzten Jahren haben wir gelernt, durch den Einsatz von regelmäßigen Open Spaces, World Cafés, Fishbowl Sessions und Retrospektiven auch mit über 30 Mitarbeitern noch zu Entscheidungen zu kommen, aber manchmal braucht das schon eine ganze Menge Moderationstechnik. Vor allem aber haben wir gelernt, nicht mehr nach der großen Lösung zu suchen. Stattdessen bemühen wir uns um kleine Schritte. Statt des großen Veränderungsprojekts setzen wir auf kleine Experimente. Die Chance, für einen Vorschlag eine Mehrheit zu bekommen, ist umso größer, je kleiner die Veränderung ist.
Wenn die Entscheidungen Kunden betreffen, lassen wir uns von den Ideen des Lean Startups leiten und experimentieren mit Kundenumfragen, mit Veränderungen auf der Web-Seite, oder indem wir bei unseren Bestandskunden nachfragen, ob sie Interesse haben, sich an einem Experiment zu beteiligen. Bei internen Fragen ist die Kernfrage immer, „Was ist die kleinste, mögliche Veränderung, um das auszuprobieren?“ Oft genug stellen wir dann fest, dass selbst diese „kleine“ Veränderung deutlich mehr Dynamik entfaltet, als wir dachten.
Ein schönes Beispiel dafür ist die Einführung der Peergroups: Zunächst war bei uns der Kreis der Seniorberater (zu dem auch die Geschäftsführer gehören) dafür zuständig, Personalgespräche zu führen und über die Einstufung der einzelnen Mitarbeiter zu entscheiden. Mit zunehmender Größe funktionierte das nicht mehr, weil wir immer weniger Einblick in die tägliche Arbeit der Kollegen hatten. Anstatt den üblichen Weg zu gehen und eine Hierarchieebene einzuziehen, wählten wir einen viel kleineren Schritt – zumindest dachten wir das: Jeder Mitarbeiter kann sich drei Kollegen suchen, mit denen er seine Personalgespräche durchführt, von denen einer ein Seniorberater sein musste. Diese Gruppe würde den Mitarbeiter in seiner persönlichen Entwicklung beraten und der Seniorberaterrunde eine Gehaltsempfehlung machen. Im Prinzip vergrößerten wir also das Gremium des Personalgesprächs „nur“.
Nachdem aber fast jeder Mitarbeiter sich plötzlich in einer Peergroup fand und damit ein Stück Verantwortung für die Kollegen übernehmen musste, wurden Fragen der persönlichen Entwicklung plötzlich von einer hierarchischen Angelegenheit zu einer Teamaufgabe. Viele Kollegen wurden damit zunächst auch aus ihrer Komfortzone herausgerissen, insbesondere bei der Diskussion der Gehaltseinstufung. Interessanterweise entsprachen aber bei der nächsten Gehaltsrunde alle Empfehlung der Peergroups auch den Einschätzungen der Seniorberaterrunde. Man war offensichtlich zu gleichen Ergebnissen gekommen. Bei einer Retrospektive nach einem halben Jahr war die Quintessenz eindeutig: Das Feedback war deutlich wertvoller geworden, die meisten empfanden das neue Vorgehen als wesentlich fairer. Einige Kollegen hatten allerdings auch das Gefühl, dass es schwieriger geworden sei, im Gehaltsgefüge aufzusteigen. Niemand, der schon eine Peergroup hatte, zog allerdings die formal noch immer mögliche Option, wieder zum alten Modell zurück zu kehren.
Mittlerweile sind die Peergroups ein fester Bestandteil der Firmenkultur. Was als Experiment gestartet war, wurde durch Selbstorganisation und emergentes Verhalten zu einem zentralen Element unseres Miteinander. Und einzelne Kollegen experimentieren bereits mit den nächsten Schritten: Zum Beispiel laden sie Kunden mit in ihre Peergroups ein, oder experimentieren mit unterschiedlichen Frequenzen. Damit das nicht in einen unkoordinierten Zoo ausartet, treffen wir uns ein- bis zweimal im Jahr zu einem „Peergrouptag“, zu dem neben einer ganzen Serie von Peergroup-Gesprächen auch die gemeinsame Reflexion und Verbesserung des Konzepts gehört, aber ohne einen Zwang zur Einheitlichkeit. Und anschließend gibt es die „Beergroup“.
Für traditionell gesinnte Manager hört sich das an, wie eine Entmachtung der Geschäftsführung und in der Tat treffen die Mitarbeiter/Gesellschafter bei uns viele Entscheidungen, die üblicherweise im Aufgabenfeld der Geschäftsführung liegen, wie zum Beispiel Personalprozesse. Allerdings empfinden wir das nicht als „Machtverlust“, sondern als wesentliche Qualitätsverbesserung. Je größer die Firma wird, umso mehr geht unsere Aufgabe weg vom operativen Management. Stattdessen kümmern wir uns mehr und mehr darum, die Selbstorganisation sicher zu stellen, die Kommunikationskanäle weit genug offen zu halten, arbeits- und selbstorganisationsfähige Einheiten zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass ausreichend unterschiedliche Positionen die Dynamik erhalten. Eine deutlich spannender Aufgabe, als Urlaubsanträge zu genehmigen (was wir übrigens abgeschafft haben). Natürlich fällt nicht jede Entscheidung so aus, wie ich oder mein Kollege Henning Wolf uns das wünschen, aber oft genug ist die gefundene Lösung zumindest ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Und auch, wenn eine Entscheidung mal nicht so gelungen ist, steht die Mannschaft zumindest dahinter und korrigiert sie, statt sie einfach zu unterlaufen.
Ist ein solcher Grad an Selbstorganisation und Emergenz für alle Unternehmen empfehlenswert? Ich denke, nein. Unser Modell basiert meiner persönlichen Ansicht nach auf einigen Voraussetzungen, die so nicht überall gegeben sind:
- Ein tolles Team, das Freude daran hat, eine etwas andere Firma zu gestalten
- Tolle Kunden, die bereit sind, auch mal ungewöhnliche Wege mit uns zu gehen
- Die Doppelrolle als Mitarbeiter und Gesellschafter, die dazu führt, dass die Gewinne nicht in einem Machtpoker zwischen Mitarbeitern und Eignern verteilt werden, sondern jede(r) auch ökonomische Verantwortung hat
- Die Tatsache, dass ein großer Teil unserer Kollegen in Moderation, Reflexion und Selbstorganisation geschult ist und sie diese Techniken auch in der täglichen Arbeit immer wieder einsetzen
- Ein hoher Level gegenseitigen Respekts
- Eine Marktstrategie, die auf Innovationskraft basiert und die notwendigen Spielräume bietet
- Der Mut und die Freude zum Experimentieren
- Eine Firmenkultur, die üblichen Status- und Machtsymbolen wenig bis gar keinen Wert bemisst
Das heißt nicht, dass man nicht auch einen Discounter mit angelernten Kräfte in Selbstorganisation führen kann, nur wird man dafür vermutlich andere Techniken einsetzen müssen.